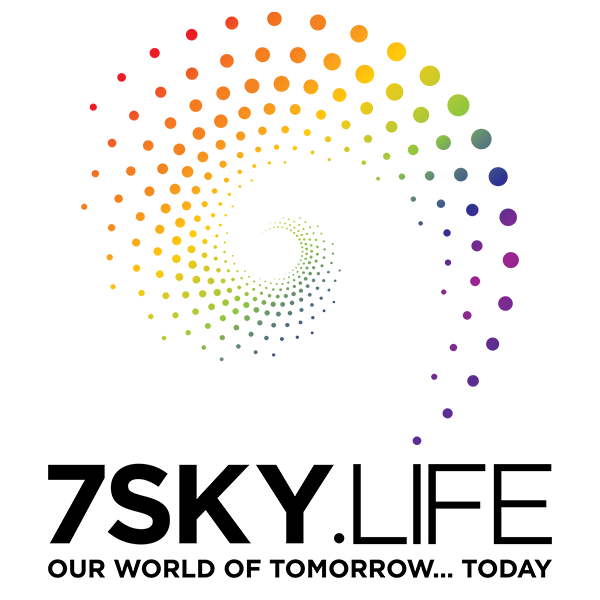Text für 7sky.life: Stephan Götzelmann
JEDER SURFER KENNT DIE LISTE VON WELLEN, DIE MAN MINDESTENS EINMAL IN SEINEM LEBEN GESURFT HABEN MUSS. KLINGENDE NAMEN WIE CLOUDBREAK, J-BAY ODER G-LAND KOMMEN EINEM DA SOFORT IN DEN SINN.MEINES ERACHTENS SIND DIESE LISTEN ABER UNVOLLSTÄNDIG. DENN EIN SPOT, DER IN SOLCHEN LISTEN NÄMLICH NIE VORKOMMT, IST SPOT Y.
Der unbekannte Spot. Anders als Spot X, der einen Secret Spot darstellt, den man von einem Local eingeflüstert bekommt, steht Spot Y vielmehr für eine Region, eine Inselgruppe oder eine unbekannte Bucht, von der man nicht weiss, ob es da überhaupt Wellen gibt, sich aber trotzdem aufmacht, um es heraus zu finden. Er steht für das Unbekannte, das Abenteuer – das Risiko, mit leeren Händen zurückzukehren. Ich finde, jeder sollte sich zumindest einmal in seinem Leben aufmachen und seinen Spot Y suchen, denn jeder der das tut, wagt einen Blick über den Tellerrand und wird wunderbares erfahren. So wie ich :
Meinen persönlichen Spot Y hatte ich schon vor fünf Jahren ins Auge gefasst. Spärliche Informationen, extrem abgelegen, Swellsituation ungewiss und ein wenig aussagekräftiges Satellitenbild waren alles, was ich hatte. Aber erst im Winter 2012 hatte ich dann die Zeit und das Geld, um diese Reise zu starten. Meine Odyssee startete im Februar mit einem Flug von Bali ins Ungewisse. Nach nur wenigen Stunden Flugzeit fand ich mich in einer neuen Welt wieder. Trotz all der Vorfreude war es dennoch ein kleiner Schock, als ich vor dem Flughafen und mitten in meinem kleinen Abenteuer stand. Kein Mensch sprach Englisch, weit und breit nur fragende Blicke, und ich hatte nichts als eine ausgedruckte Seekarte dabei. Das kam dann doch etwas abrupt. Einen kurzen Moment lang fragte ich mich, ob ich das jetzt wirklich machen will und nicht wieder zurück in bekannte Gefilde flüchten sollte. Doch einmal tief durchgeatmet, all meine spärlichen indonesischen Sprachkenntnisse mobilisiert und schon ging es mit einem Auto zu dem Hafen, indem die Boote zur nächsten Insel warteten. Mein Abenteuer konnte beginnen ! Was folgte, waren eine Stunde Bootsfahrt und vier Stunden Autofahrt – vorbei an unzähligen Buchten, Traumstränden und Vulkangipfeln. Rechtzeitig zur Abenddämmerung kam ich dann in einer mittelgrossen Hafenstadt an. Der Ausgangspunkt zu meinem Spot Y. Das erste Hotel in das ich kam war schrecklich. Überteuert, durchgeschwitzte Matratzen und katzengrosse Ratten, die aus meinem Zimmer kamen waren die Begrüssung. Doch nach einem ganzen Tag auf den Beinen war ich zu erschöpft, um abzulehnen. Da es keine Moskitonetze gab, versuchte ich in der Tropenhitze mit Pullover, langer Hose und Socken von schöneren Dingen zu träumen. Es heisst ja, der Weg ist das Ziel, aber solche Etappen könnte ich getrost streichen.Der nächste Morgen begann mit viel Wartezeit. Das Boot auf die nächste Insel musste voll sein bevor es losging, doch bis sich 30 Passagiere gefunden hatten, vergingen Stunden. Als dann zur Mittagszeit immer noch nicht genügend Leute da waren, wurde es dem Kapitän zu bunt. Die Liste wurde spontan halbiert und es konnte endlich losgehen. Nach einer zweistündigen Bootsfahrt kam ich dann endlich auf der Insel an, die mir schon vor Jahren ins Auge gefallen ist. Doch am Ziel war ich noch lange nicht. Ich war im Süden der Insel, und mein Ziel war der äusserste Norden – ca. 100 Kilometer entfernt. Glücklicherweise fand ich einen Fahrer, der mich mit dem Auto ein Stückchen weiter brachte. Doch diese Etappe hatte es in sich. Die anfangs asphaltierte Strasse entwickelte sich nach wenigen Kilometern zu einer Schotterpiste mit Gefällen, die jeder Achterbahn Konkurrenz machten. Öfters mussten wir aussteigen und mit mehreren Versuchen unglaubliche Steilstücke überwinden. Nach einer schweisstreibenden Stunde Achterbahnfahrt dann die erste Panne. Ein platter Reifen. Wieder warten. Ich nutzte die Zeit bis der Reifen geflickt wurde und erkundete die Strände in der Umgebung. Obwohl der Swell hier nicht mit voller Wucht aufprallte, brachen schulterhohe Wellen. Nach zwei Tagen Reisezeit endlich ein Lichtblick ! Ich konnte es kaum erwarten, den Norden zu sichtigen. Doch mein Ziel liess weiterhin auf sich warten, denn kurz nach unserer Reifenpanne stand schon das nächste Hindernis bereit. Starke Regenfälle hatten ein ca. 500 Meter langes Strassenstück in einen braunen See verwandelt. Vor dem See hatte sich auch schon eine kleine Kolonne mit gestrandeten Menschen gebildet. Das war’s für heute. Uns blieb nichts anderes übrig als zu warten, bis das Wasser abgeflossen war. Wie lange das dauern sollte, wusste keiner. Des Nachts kam plötzlich Bewegung in die Truppe. Wir schulterten unser nötigstes Gepäck und wateten im Mondschein durch das immer noch hüfthohe Wasser – romantisch und gruselig zugleich. Am anderen Ende des Sees wartete schon ein Auto und brachte alle Gestrandeten ins nächste Dorf. Glücklicherweise hatte mein Fahrer dort Verwandte, bei denen ich für eine Nacht unterkommen konnte.
Am folgenden Tag organisierte ich zwei Fischer, die mich mit dem Kanu weiter in den Norden brachten, denn ab hier gab es keine Strassen mehr, nur noch Dschungel, Ozean und hoffentlich Wellen. Da jedoch Sonntag war, musste ich erst den Gottesdienst abwarten. Somit verging wieder ein wenig Zeit und wir starteten erst am frühen Nachmittag. Das sollte sich nach einigen Stunden Fahrt rächen. Denn obwohl sich die Sonne schon bedrohlich dem Horizont näherte, waren wir noch weit vom Ziel entfernt. Die Wellen wurden immer grösser und eine Weiterfahrt in Dunkelheit war undenkbar. Wir mussten an Land. Aber wo ? Die gesamte Küstenlinie hatte einen vorgelagerten Korallenstreifen, auf denen mittlerweile riesige Wellen detonierten. Es war wie ein unüberwindbarer Zaun, der einen Landgang verhinderte. Langsam wurde die Stimmung etwas angespannt und unsere Lage schien aussichtslos. Doch dann entdeckte einer der Fischer einen winzigen Pass im Riff. Keine 20 Meter breit und an beiden Seiten explodierte das Wasser. Eine Welle schälte sich in tödlich seichtem Wasser ab – schön, aber vermutlich unsurfbar. Wir fuhren die kleine Passage hindurch und was sich dann vor uns aufmachte, war schier unglaublich. Vom Meer aus kaum zu sehen, mündete ein mächtiger Fluss in einer majestätischen S-Kurve in den Ozean. Links und rechts ragten dicht bewachsene Felswände in den Himmel. Und ganz oben : Ein Märchendorf ! Winzige Hütten, im Wald eingebettet wie im Auenland. Unten am Fluss sprangen nackte Kinder vergnügt von Felsen ins Wasser. Es war wie ein kleines Paradies ! Als die Kinder uns entdeckten wurde es Totenstill. Sie hörten auf zu spielen und einige Erwachsene kamen, um nach dem Rechten zu sehen. Als wir in die kleine Bucht einfuhren, schauten uns von beiden Ufern lautlose Menschen an – ein magischer Moment. Als wir an einer Sandbank anlegten und unsere Lage zu verstehen gaben, löste sich die Anspannung und eine kleine Menschenmenge versammelte sich um uns. Alle wollten wissen wer wir sind und was wir hier wollen.
Nach einigen Gesprächen gingen wir zum Dorfchef, um uns die Erlaubnis für eine Übernachtung einzuholen. Der gut genährte Mann war sichtlich entspannt und gab uns die Erlaubnis. Was dann folgte lässt mir immer noch das Herz aufgehen wenn ich daran zurückdenke. Wie in der Nacht zuvor boten mir wildfremde Leute ihr eigenes Bett an, indem Sie zu viert schliefen. Sie räumten das Schlafzimmer und schliefen selbst am Boden. Dazu bekam ich Essen und Trinken serviert, ohne danach zu bitten. Und all das umsonst ! Selbst das Geld, das ich ihnen freiwillig zustecken wollte, wurde dankend abgelehnt. So etwas muss man sich erstmal vorstellen : Diese Leute haben fast nichts, und selbst wenn ihnen leicht verdientes Geld angeboten wird, lehnen sie es ab. Das ist wahre Gastfreundschaft, die es selbst in Indonesien nicht überall zu finden gibt.
Gleich am nächsten Morgen bedankten wir uns für die immense Hilfe und setzten unsere Reise gen Norden fort. Es war ein wunderschöner Tag und vor uns leuchtete das Meer tiefblau – daneben der Dschungel im satten grün. Wir waren mittlerweile in eine extrem abgelegene Region vorgedrungen, die wild und abenteuerlich wirkte. Nach einigen Stunden Fahrt passierten wir dann die letzte Landzunge und vor uns machte sich dann endlich die Bucht auf, die ich seit fünf Jahren besuchen wollte. Mein Spot Y ! Es war eine grosse Bucht, eingerahmt von hohen, dicht bewachsenen Bergen. Die Farbe der Strände änderte sich abwechselnd von Weiss zu Schwarz und im kristallklaren Wasser thronten sagenhafte Korallengärten. An unzähligen Stellen brachen atemberaubende Wellen. Tief in der Bucht schlummerte zwischen den Palmen ein kleines Dorf. Wir legten an. Ich war kaum aus dem Kanu gestiegen, da kam mir schon eine lachende Frau mit kugelrundem Babybauch entgegen und führte mich zu ihrem Haus. Sie wusste sofort, dass ich Surfer bin und für eine Weile bleiben will. Ich war anscheinend nicht der erste, der hierher kam. Die Familie schien nett zu sein und ich willigte ein, bei ihnen zu wohnen.
Kurz nach meiner Ankunft traf ich dann andere Surfer. Es gab sie wirklich. Andere Abenteurer, die denselben mühevollen, aber wertvollen Trip hinter sich hatten wie ich. Es waren lustige Charakteren aus Frankreich, Australien, England und Irland. Und ich war einer von ihnen. Zusammen surften wir Woche für Woche die einsamen und äusserst anspruchsvollen Wellen in der Bucht. Wir hatten ein einfaches, aber gutes Leben. Meine Gastfamilie war die netteste Gruppe an Menschen, die man sich vorstellen konnte. Es gab eine Oma, die mich stark an meine eigene Grossmutter erinnerte. Sie liess mich nie surfen gehen bevor ich nicht ausreichend gegessen hatte. Makan Dulu ! (Essen zuerst !) hiess es immer. Dann war da der Vater. Ein junger, aufrichtiger und hart arbeitender Mann, der alles gab, um seine Familie zu ernähren. Dann gab es zwei Rotzlöffel, die nur Unfug im Kopf hatten und alle auf Trab hielten. Und dann war da die Mutter. Sie war hochschwanger, was sie aber nicht davon abhielt den Haushalt zu schmeissen. Als ich eines Tages vom Surfen nach Hause kam, war sie nicht da. Ihr Mann erzählte, dass sie mit starken Bauchschmerzen im Bett liegt und es ihr nicht gut ging. Er war sichtlich besorgt. Dieser Ort war dermassen abgelegen, dass nur einmal in der Woche ein Boot vorbeikommt, um Kokosnussfleisch für die Ölherstellung abzuholen. Das nächste Krankenhaus war eine Tagesreise entfernt. Hier ein Kind zu bekommen ist nicht einfach. Im Laufe des Tages kam das halbe Dorf ins Haus, um für sie und das Baby zu beten. Es war alles, was sie machen konnten. Ich hörte nur Schreie und intensives, lautes Beten aus dem Nebenzimmer. Die Beterei und das stöhnen ging bis in die Nacht hinein, als um ca. vier Uhr Babygeschrei aus dem Zimmer kam ! Alle waren erleichtert, aber der grösste Stein viel sichtlich dem Ehemann vom Herzen. Er sprach noch tagelang wie dankbar er für den Ausgang dieser Nacht sei.
Die Tage im Dorf vergingen wie im Flug und schliesslich war auch meine Zeit auf der Insel vorbei. Alle waren ein wenig traurig bei der Verabschiedung, aber ich versprach wieder zu kommen. Ein Versprechen, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich es einhalten kann. Als ich im Boot Richtung Heimat schipperte, liess ich die Erlebnisse der letzten Wochen rekapitulieren. Ich war so dankbar für das, was ich während dieser Odyssee erlebt hatte. Es war ein Trip, so reichhaltig an Erlebnissen, die man nicht in Pauschalreisen, oder im Lonely Planet findet. Ein Trip, der mich in Situationen gebracht hat, bei denen ich komplett von anderen Menschen abhängig war. Aber genau dieses Gefühl – von wildfremden Menschen aufgenommen und Hilfe zu bekommen – war so erfüllend und stärkte den Glauben an das Gute im Menschen. Eine Lektion, die man nicht oft gelehrt bekommt. Ich kann nur jedem raten : Macht so eine Reise ! Begebt euch ins Ungewisse, geht aufs Risiko, und ihr werdet als ein besserer Mensch zurückkommen. Jeder kann ein Charterboot, oder ein Surfcamp buchen, aber nur die Mutigen, die sich selbst auf die Suche nach Neuem, Unbekanntem machen, neue Pfade beschreiten, denen wird eine Reise beschert, die einem für den Rest des Lebens mit wirklich einzigartigen Erinnerungen begleiten wird – macht euch auf die Suche des Spot Y.
Für 7sky.life – Stephan Götzelmann